Roman
426 Seiten
ISBN: 978-3-9502871-2
 |
| Leben ist ein Nebenjob |
Leseprobe
Kapitel 33
Schneekatastrophe
So weit die Füße tragen
Cindy kam jetzt mit dem Firmenwagen nach Hause. Unser Audi hatte ja beim Unfall einen Totalschaden erlitten. Nachmittags begann es zu schneien und wir freuten uns über den Schnee. Wir kochten uns heißen Punsch und fühlten uns ganz wohl in unserem kleinen Haus, in dem die Öfen ordentlich gefüttert wurden und behagliche Wärme ausstrahlten.
In der Nacht wurden wir durch Sirenengeheul geweckt, das sehr nah zu sein schien. »Das ist doch bei uns vor der Tür«, sagte Cindy und ich stand auf, um aus dem Wohnzimmerfenster zu sehen. Schon in der Küche gewahrte ich einen hellen Lichtschein. Das schräg gegenüberliegende Gebäude, das eine Wurstfabrik beherbergte, brannte lichterloh. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr waren in klirrender Kälte bei der Arbeit. Glücklicherweise war das Haus zu weit entfernt, um uns zu gefährden. Nach einigen Stunden hatten sie das Feuer gelöscht und zogen wieder ab.
Am nächsten Morgen kam Cindy, die das Haus gerade auf dem Weg zur täglichen Fron verlassen hatte, überraschenderweise nach zwei Minuten wieder zurück. »Das musst du dir mal angucken.«
Der Creativshop-Wagen war direkt vor der Fleischfabrik geparkt und wies jetzt eine Eisschicht von circa fünfzehn Zentimeter Dicke auf. »Gefrorenes Löschwasser«, stellte ich fest, »den kannst du erst wieder benutzen, wenn es getaut hat.«
»Scheiße, jetzt muss ich mit dem Bus fahren. Wer weiß, wann ich dann in der Firma bin.«
»Ja und bei dem Schneetreiben fließt der Verkehr auch nicht wie sonst.«
»Heute muss ich unbedingt nach Hamburg, ich wollte doch noch bei meiner Mutter vorbei. Die jammert mir schon tagelang die Ohren voll, weil sie wieder Ärger mit ihrem österreichischen Seemann hat.« Es war gar nicht so selten, dass die Schluchtenscheißer sich für diesen Beruf entschieden.
»Der Arsch macht nur Mist und sie schickt ihn trotzdem nicht zum Teufel. Irgendwie hat sie auch selbst Schuld. Na ja, es ist halt meine Mutter.« Sie entschwand zur Bushaltestelle und ich betrachtete das immer stärker werdende Schneetreiben. Die Lage wurde dadurch noch verschärft, dass ein eisiger Wind blies, der dafür sorgte, dass sich der Schnee an manchen Stellen des Deiches türmte. Laufend fuhren Schneepflüge, um die Straßen befahrbar zu erhalten. Das sah mir verdächtig nach Sisyphusarbeit aus.
Ich kochte mir eine Kanne Tee, frühstückte und machte mich daran, den Weg zum Schuppen, in dem sich der Heizöltank für die Öfen befand, freizuschaufeln. Ein bisschen Spaß machte mir dieser Ausnahmezustand schon, denn er brachte Farbe in meinen Alltag. Als ich mächtig gegen das immer stärker werdende Schneetreiben angeschaufelt hatte, war das Gefühl beim Trinken einer heißen Hühnerbrühe wohliger als sonst und ich dachte: »Die hast du dir jetzt redlich verdient.« Wie köstlich konnte so eine Brühe doch munden, wenn man vorher geackert und gefroren hat.
Selbst am Tag war es draußen nicht richtig hell. Im Haus war es dadurch sehr düster. Gegen Abend überlegte ich mir, was ich für mich und meine Süße kochen sollte und wartete auf ihre Heimkehr. Dass sie eine Stunde überfällig war, war bei dem Wetter noch normal. Zwei Stunden später war sie immer noch nicht zu Hause. Jetzt fiel mir auch auf, dass schon seit Langem kein Bus mehr vorbei gefahren war. Zum ersten Mal bereute ich es, kein Radio zu haben. Ich wusste nicht, was Sache war. Wahrscheinlich war der Verkehr zusammengebrochen. Nichts fuhr mehr. Ich kombinierte, dass meine Kleine bei ihrer Mutter in Hamburg-Eimsbüttel geblieben war, und richtete mich auf eine einsame Nacht ein. Das nächste Telefon befand sich nicht weit vom Haus entfernt. Ich wollte zumindest wissen, dass bei Cindy alles im grünen Bereich war, und war zudem neugierig über ihren Kenntnisstand der Situation.
Ich stapfte durch den Schnee zum öffentlichen Fernsprecher. Durch den Wind war es saukalt. Ich warf das Geld ein und wartete. Nach kurzer Zeit war mein Engel schon am Telefon. Sie hatte schon auf meinen Anruf gewartet.
»Scheiße, ich komm’ hier nicht mehr weg«, sagte sie genervt, »und wenn das so weitergeht, dann morgen erst recht nicht.«
»Ist Charly da?«
»Nein, der hat wieder angeheuert und meine Mutter überlegt jetzt, ob sie ihn endgültig in die Pampa schickt. Sie hat die Nase voll von dem Suffkopp.«
»Na ja«, wollte ich mich selbst beruhigen, »solange noch ein paar Lebensmittel und Wein da sind, werd’ ich’s überleben ohne dich. Aber Sehnsucht habe ich jetzt schon.«
»Ich auch, mein Schatz. Es ist höhere Gewalt. Vielleicht möchte das Schicksal uns mal zeigen, wie es ist, wieder allein zu sein.«
»So als kleine Warnung, wenn wir uns streiten und ich mir denke, was soll ich eigentlich bei der dusseligen Kuh. Also, lass dich nicht von deiner Mutter nerven und sei froh, dass Charly nicht da ist.«
»Ja, Schatz, ruf morgen wieder an.«
»Mach’ ich, tschüs.«
»Tschüs.« Ich legte auf und trollte mich. Erst einmal einen Punsch und was zu essen war jetzt die Devise. Als ich satt war und der Alkohol ins Blut stieg, ging es wieder los. Dieses Mal konnte ich mir das gut erklären, denn ich fühlte mich unendlich allein und ausgeliefert. Erklärung hin, Erklärung her, die Nacht war furchtbar. Ich versuchte bei Licht zu schlafen, weil ich dachte, dass mich im Dunkeln die Dämonen abholen. Mit rationalen Gedanken war dem nicht beizukommen. Die Angst und das Unbehagen waren schlimmer.
Am nächsten Morgen öffnete ich die Haustür und sah statt der Straße nur weiß. Und was ich sah, war keine weiße Straße, sondern eine weiße Wand. Der Schnee hatte sich bis zur Dachrinne aufgetürmt.
Mit einem »Ach du Scheiße«, stürzte ich zur Hintertür, die zum Garten und zum Schuppen führte. Hier war es möglich, hinauszugelangen und wieder einen Weg zum Schuppen zu bahnen. In weiser Voraussicht hatte ich Schaufel und Schneeschieber gleich neben der Tür zum Garten deponiert. Den Weg zum Schuppen freizuschaufeln war ein schlimmes Geacker. Ich füllte die Tanks der Ölöfen vorsichtshalber randvoll. Beim Frühstück dachte ich mir, noch so eine Nacht muss ich nicht noch einmal haben. Aber das Chaos war perfekt. Wie sollte ich hier wegkommen? Fuhren in Hamburg überhaupt Bahnen und Busse? Und wenn ja, dann ab wo? Mit der Bahn konnte ich erst ab Altona wieder weiter fahren. Ich musste also zwangsläufig den Bus nehmen. Der Gedanke, hier wegzukommen, schmolz dahin. Die Straßen waren bei diesem Chaos am schwierigsten frei zu halten. Ich musste erst wieder telefonieren.
Cindy konnte Nachrichten hören und fernsehen. Ich erfuhr von ihr, dass Panzer eingesetzt würden, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. Die Busse würden teilweise fahren, aber in Richtung Altona erst ab der Ortsmitte von Finkenwerder. Ich schluckte und sagte ihr, ich würde es trotzdem versuchen. Mein Vorhaben bedeutete, dass ich mich circa fünfzehn Kilometer durch den Schnee kämpfen musste. Ich wusste aber nicht, was mich am Elbdeich erwartete, wo das Land offen war. Der Schneesturm wurde hier nicht durch Bebauung abgemildert. Im Frühling hätte ich über diese Entfernung gelacht und mich sicher sofort auf den Weg gemacht. Bei diesem Unwetter musste man sich schon besser vorbereiten. Auf der anderen Seite wollte ich auf keinen Fall noch eine Nacht allein verbringen und außerdem war die Sache auch eine Herausforderung.
Ich erinnerte mich an Fernsehreportagen, die sich mit Polarforscher- oder Bergsteigerthemen befassten und wusste, dass ein Mensch in der Kälte viel Energie verliert. Also packte ich mir viel Schokolade und Kekse ein. Cindy hatte sich einen kleinen Schokovorrat angelegt, den ich jetzt plünderte. Dann kochte ich eine Kanne Tee und goss sie in die Thermosflasche. Von der Bundeswehr besaß ich noch lange, olivfarbene Unterhosen, und den Parka hatte man nach der Wehrdienstzeit auch behalten dürfen. Im Nachhinein war die Truppe doch noch zu etwas gut. So ausstaffiert und mit dicken Socken und Winterstiefeln machte ich mich auf in die Kälte.
Oben auf dem Deich, im Schutz der Häuser, konnte man ganz gut gehen. Vereinzelt versuchten Leute, ihre verschneiten Einfahrten freizuschaufeln. Ein älterer Mann, den ich nur vom Sehen kannte, fragte mich: »Wo wiss du denn hin, mien Jung?«
»Ich geh nach Hamburg.« So ein erstauntes Gesicht hatte ich schon lang nicht mehr gesehen.
Jemand fragte mich, ob ich zum Krämer wolle, der hätte nicht mehr viel zu bieten und ob ich etwas bräuchte. Die Menschen waren plötzlich wie ausgewechselt. Es herrschte eine Atmosphäre von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Warum braucht ihr erst eine Katastrophe, um das Maul aufzukriegen? Wäre doch nett, wenn es immer so wäre, dass man sich um den anderen kümmert. Ich lehnte mich gegen den Wind und ging weiter. Kurz vor dem Ortsausgang nahm ich einen kräftigen Schluck Tee und aß einen Riegel Schokolade. So, Junge, nu’ wird’s heftig.
An der Elbe machte ich Bekanntschaft mit Sankt Püsterich. Die einzige Möglichkeit durch zu kommen war, sich auf dem Deich zu bewegen. Die Verwehungen hatten die Straße bis auf halbe Deichhöhe geschluckt. Ab und zu schaute ein Autodach aus dem Schnee heraus. Panzer mit Schneeschiebern kamen mir entgegen. Wer sein Auto nicht akkurat am Straßenrand abgestellt hatte, musste damit rechnen, eine beschädigte Karre vorzufinden. Hier oben zu gehen, glich dem Waten durch brusthohes Wasser. Es stürmte heroben heftig, aber es war wie gesagt die einzige Möglichkeit vorwärts zu kommen. Unten war Tiefschnee, man wäre vollkommen darin versunken und möglicherweise von Panzerketten erfasst worden.
Ich musste an die Expedition von Amundsen und Scott denken und kam mir dabei lächerlich vor. Du gehst hier durch zivilisiertes Gebiet und die Jungs waren buchstäblich am Arsch der Welt. Völlig auf sich allein gestellt. Was für Helden. Was für ein Kraftakt. Aber was hatte sie angetrieben, so etwas zu tun? Die Gier nach Ruhm oder die Neugier des Entdeckers? War es die Herausforderung gewesen, die Natur zu besiegen? Was für ein Irrsinn war dieser Gedanke im Angesicht der begrenzten menschlichen Möglichkeiten. Scott hatte die Arschkarte gezogen, weil er glaubte, mit Pferden durchzukommen. Amundsen hatte ganz klar auf Hundeschlitten und Ski gesetzt. Seine Herkunft und seine Erfahrungen waren ihm hierbei von Vorteil gewesen.
Ich teilte meine Wanderung in Etappen ein. Erste Etappe: bis zum Ortsausgang Cranz. Die hatte ich genommen und befand mich jetzt auf der Geraden bis zur ersten Kurve.
Lange Geraden haben die schlechte Angewohnheit, unendlich zu erscheinen. Mein Ziel rückte zu langsam näher. Das Dunkelgrau des Himmels vereinigte sich mit dem grauen Wasser der Elbe zu einer konturlosen, übergangsfreien Masse.
Der Rotz aus meiner Nase floss auf meinen Schnurrdiburr, den ich über der Oberlippe trug. Erinnerungen an die Kindheit wurden wach, als ich den sogenannten »Schnodder« einfach wegleckte. Das ging doch ganz gut. Man ersparte es sich, die Handschuhe auszuziehen und kriegte keine kalten Hände.
Die zweite Etappe ließ ich hinter mich und bog auf die lange, schnurgerade Strecke zum Ortseingang von Finkenwerder ein.
Was musste der Alte in Russland erlebt haben! Wenn er sein Rendezvous mit Väterchen Frost nicht abgebrochen hätte, als er im Schnee gelegen hatte, verwundet durch einen Granatsplitter im Handgelenk, wäre ich heute nicht hier.
Er hatte mir erzählt, dass er damals immer müder geworden und schon über die Frierphase hinweg gewesen war. Es hatte ihm schon nichts mehr wehgetan. Aber der Wille zum Überleben hatte ihm geholfen, sich weiter zu schleppen, bis er bei seinen Kameraden war. Bei der Aktion hatte er seine Hand verloren. Sie war nicht mehr zu retten gewesen und musste amputiert werden.
Meine Sorgen wirkten bei diesen Gedanken geradezu winzig. Wir Kinder des Wirtschaftswunders waren doch im Vergleich zu diesen Menschen Weicheier.
Stapf, stapf, stapf. Schritte zu zählen, war langweilig.
»Geh meditativ«, sagte meine innere Stimme. Ich hielt nur kurze Zeit durch, dann kamen die Gedanken wieder zurück. Vielleicht klappte es mit einem Mantra.
»Om-go, om-go, om-go«, das lullte einigermaßen ein. Um nicht zu viel Energie zu verschwenden, flüsterte ich es leise vor mich hin. So hatte ich die dritte Etappe genommen.
Der Ortseingang von Finkenwerder beendete meine Meditation. So, mein Kleiner, jetzt noch einmal alles geben. Warum müssen diese verfluchten Dörfer bloß so elend lang sein? Bis zum Ortskern waren es noch einige Kilometer.
Die nächste Assoziation in meinem kalten Schädel befasste sich mit einem der Straßenfeger des 60er-Jahre-Fernsehens. Der Film bestand aus mehreren Teilen und handelte von der Flucht eines deutschen Soldaten aus der russischen Gefangenschaft. Der Titel war ›Soweit die Füße tragen‹. Bei jeder Folge dieses Streifens waren die Straßen leer gefegt wie bei der WM. Ich versuchte mir zum Zeitvertreib die Handlung ins Gedächtnis zu rufen, was mir aber nur weniger gut gelang.
Wie glücklich mussten die Bewohner von Finkenwerder, die an der Hauptstraße wohnen, doch in diesen Tagen sein. Kein Lärm, kein Gestank durch Autoverkehr. Diese Straße war sonst so stark frequentiert wie die B 73, eine der meistbefahrenen Bundesstraßen Deutschlands. Lebensqualität konnte ich mir hier unter normalen Umständen nicht vorstellen. Ich wünschte den Anwohnern noch viele ruhige Tage.
Der Ortskern rückte langsam aber sicher näher. In einigen Hundert Metern Entfernung meinte ich, eine Menschentraube zu sehen. Als ich näher kam, gerann mein Wunsch, der Vater dieses Gedankens, zur Realität. Die Leute warteten auf einen Bus. Hoffentlich kam zuerst der 150er nach Altona.
Die Wartenden waren in Gespräche vertieft und lachten. Jeder hatte etwas zu erzählen, ich sah freundliche Gesichter. Auf mich machte das den Eindruck, als wäre ich in einem südlichen Land.
Im Bus ging es genauso zu. Was war mit den Menschen passiert? Ich war immer kommunikativ im Bus. Manchmal wurde ich wie ein Alien angeguckt, weil ich wildfremden Leuten etwas zu sagen hatte. Besonders die Männer reagierten erstaunt und maulfaul. Möglicherweise fragten sie sich: »Ist der schwul?«
Jetzt redeten sie alle. Und ihre Gesichter bewegten sich sogar. Sonst waren Mimik und Gestik rar. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Mitreisenden würden unter peripherer Fazialislähmung leiden. Da waren nur versteinerte, traurige Gesichter der Menschen, die unter dem täglichen Trott litten, sich aber scheinbar damit abgefunden hatten. Unbeseelte Hüllen auf dem täglichen Gang nach Canossa, die sich jeden Tag erniedrigten in einer entfremdenden Tätigkeit. Buckelnd vor den Bossen. Erfüllungsgehilfen für eine glücklichere Welt, an der sie nie teilhaben werden. Doch sie bekamen diese bessere Welt jeden Tag im Fernsehen vorgesetzt.
Der einzige, unwahrscheinlichste Weg, der Fron zu entfliehen und auch in der Welt der Schönen und Reichen leben zu können, war der Lottoschein, den ich immer den »proletarischen Strohhalm« nannte. Leise sang Springsteen in meinem Kopf.
»Early in the morning, factory whistle blows,
man rises from bed and puts on his clothes …«
Jetzt, da ich die fröhlichen Menschen sah, wurde mir bewusst, dass auch ich so versteinert werden könnte und beschloss, diesem grauenhaften Trott soweit wie möglich zu entgehen.
Altonaer Bahnhof. Die Bahnen fuhren. Nach einiger Zeit tauchte ich an der Osterstraße aus dem Untergrund auf und ging die letzten Schritte zum Hellkamp, so hieß die Straße, in der meine zukünftige Schwiegermutter wohnte. Ich bedankte mich bei irgendeiner höheren Macht und drückte auf den Klingelknopf. Selten war ich so froh, meine Liebste zu sehen und sogar meine Schwiegermutter. Wer kann das schon von sich behaupten.
Im Folgenden bekam ich Vollversorgung: Heiße Suppe, Rumgrog und einen Platz zum Liegen auf dem Sofa inklusive einer wärmenden Decke. Es durchfloss mich ein heißes Glücksgefühl, das aufgrund seiner Intensität kaum zu ertragen war. War das schön.
Im Fernsehen verfolgte ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Dörfer waren eingeschneit, es gab Stromausfälle und außerhalb der Metropolen war der Verkehr im Norden zusammengebrochen. Mir wurde bei diesem Anblick bewusst, wie abhängig wir von den Verkehrsmitteln und insbesondere von Elektrizität waren. Gut, dass ich die Öfen im Cranzer Haus auf kleiner Flamme hatte brennen lassen. Wir würden wohl etwas länger hier verweilen müssen und hätten bei der Rückkehr ein völlig ausgekühltes Haus gehabt.
Die Nacht wurde mit einem herrlichen Abendfick im elterlichen Ehebett eingeleitet. Ich registrierte dabei, warum es ausgesprochen vorteilhaft war, einen großen Spiegel im Schlafzimmer zu haben.
Bitte E-Book-Format wählen:
Leben ist ein Nebenjob
Ein Roman von Uwe Prink

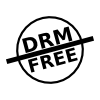
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen